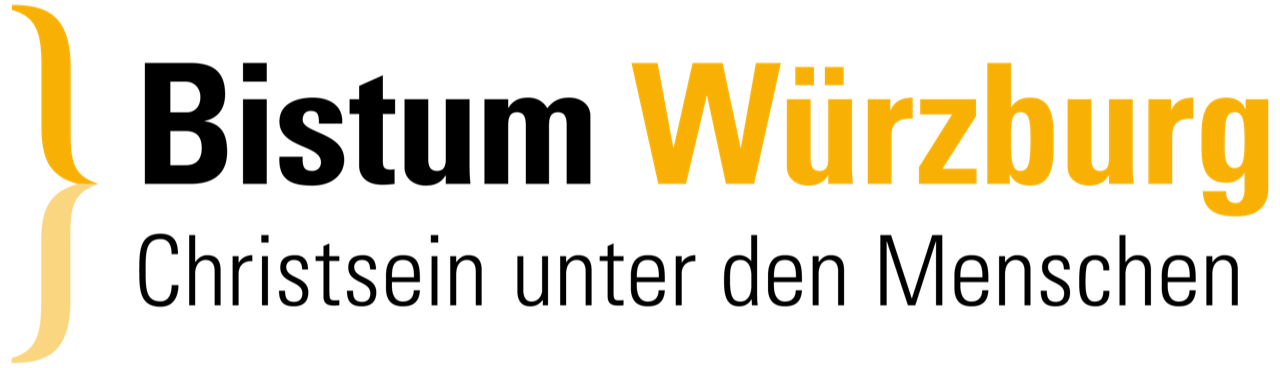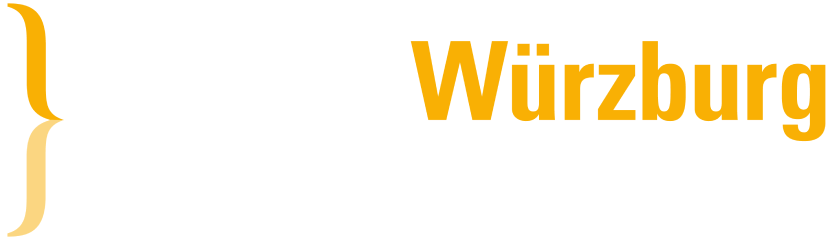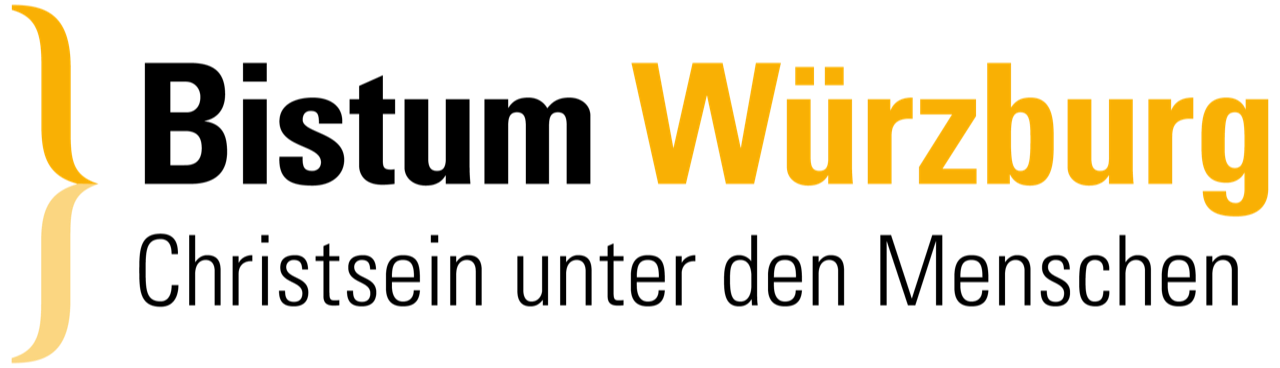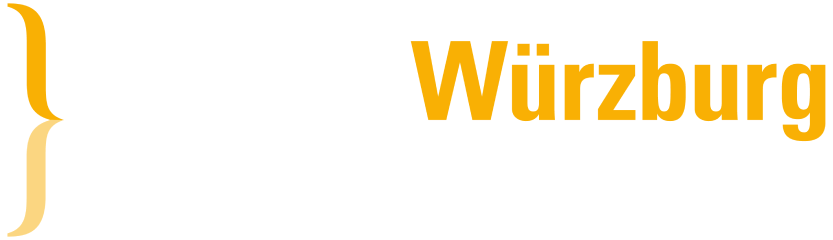Würzburg (POW) Mit dem Ende des Konzils von Trient vor 450 Jahren hat sich die Jahresversammlung des Würzburger Diözesangeschichtsvereins beschäftigt. Hauptreferent Professor Dr. Anton Schindling (Tübingen) zeigte die große Bedeutung der Tridentiner Kirchenversammlung für die Entwicklung des neuzeitlichen Katholizismus und die Schwierigkeiten des damaligen deutschen Reiches mit dem Konzil auf. Bei dem Treffen am Freitagnachmittag, 15. November, im Diözesanarchiv Würzburg stellte Professor Dr. Wolfgang Weiß, Vorsitzender des Diözesangeschichtsvereins, die neuesten Ausgaben der Würzburger Diözesangeschichtsblätter und der „Quellen und Forschungen“ vor.
Deutlich machte Schindling in seinem Vortrag, dass das Konzil in die intensive Verknüpfung von Reich und Reformation hineingehöre. „Das Konzil war von Anfang an eine politische Sache.“ Kaiser Karl V. habe die Protestanten abgelehnt und in der beginnenden Glaubens- und Kirchenspaltung das Konzil als mögliche Lösung des theologischen Dissenses zwischen Altgläubigen und den Anhängern des Augsburger Bekenntnisses gesehen. Mit großer Nachdrücklichkeit habe der Kaiser den Konzilsgedanken verfolgt, während die Päpste nicht begeistert gewesen seien. Eher unwillig habe Papst Paul III. auf Drängen des Kaisers ein Allgemeines Konzil der Abendländischen Kirche nach Trient einberufen.
Zwischen deutschem Reich und Konzil habe es von Anfang an Schwierigkeiten gegeben. „Das Konzil von Trient ist aus deutscher Sicht wohl immer etwas problematisch gewesen. Es war vor allem ein Konzil der romanischen Völker.“ Bei allen drei Tagungsperioden seien nur wenige Deutsche anwesend gewesen. Die wichtige Schlussphase 1562/63 sei weitgehend ohne deutsche Beteiligung abgelaufen. Die Reichskirche habe mit den Trienter Beschlüssen nur teilweise etwas anfangen können: „Die dogmatischen Dekrete konnte man übernehmen, aber die Reformdekrete vor allem zum Bischofsamt waren in der Kirche des Reiches mit ihren weltlichen Herrschaftsrechten schwer umsetzbar.“ Die geistlichen Amtsträger hätten sich in erster Linie als Fürstbischöfe verstanden. Überkommene Strukturen seien bis zur Säkularisation bewahrt worden.
Die Rezeption des Konzils in der Kirche des deutschen Reichs bezeichnete der Tübinger Historiker als recht verhalten. Gegenüber den tatsächlichen Vorgängen in Trient habe sie sich zum Teil verselbständigt. Massive Kritik übte Schindling am von der Piusbruderschaft vertretenen Bild des Konzils von Trient, das „ein ideologisches Konstrukt des 19. Jahrhunderts“ sei. Mit den tatsächlichen Ereignissen von Trient habe das nichts zu tun.
Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand übermittelte die Grüße von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann und dankte Vorsitzendem Weiß und Archivdirektor Professor Dr. Johannes Merz für die konstruktive Zusammenarbeit im Diözesangeschichtsverein. Gleichzeitig bat er um das Engagement der Mitglieder, um die solide Arbeit des Vereins weiterführen zu können. Um die Grundlagen der künftigen diözesangeschichtlichen Forschungen für morgen zu erhalten, könnten die Mitglieder das Diözesanarchiv dabei unterstützen, die schriftlichen Nachlässe der Seelsorger und weiterer für das Bistum Würzburg bedeutsamer Persönlichkeiten zu sichern.
Den 76. Band der Würzburger Diözesangeschichtsblätter und den 66. Band der „Quellen und Forschungen“ stellte Vorsitzender Weiß vor. Zwei umfangreiche Abhandlungen beschäftigten sich mit der Würzburger Bischofsreihe von 1617 bis 1803 und mit dem kirchlichen Leben der Pfarrei Kleinostheim in den Umbrüchen des 19. Jahrhunderts. Weitere Beiträge gingen auf die Geschichte und Theologie des Würzburger Doms ein, stellten die Klosterlandschaft des Bistums als GIS-Projekt vor und behandelten die Geschichte von Burg und Amt Prozelten, die Zeit der Hussitenkriege im Bistum sowie die Vorgänge um den Pfeifer von Niklashausen. Drei Aufsätze widmen sich nach den Worten Weiß‘ Themen des 19. und 20. Jahrhunderts und beschäftigen sich mit der Kirche in Albstadt, der Rückkehr der Benediktiner nach Münsterschwarzach und der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. In den „Quellen und Forschungen“ biete Hermann Fischer eine umfassende und detaillierte Bestandsaufnahme der Orgeln, die von der aus dem Grabfeld stammenden Orgelbauerfamilie Schlimbach erstellt wurden.
Nach Angaben von Weiß zählt der Diözesangeschichtsverein derzeit 513 persönliche sowie 61 institutionelle Mitglieder. Stellvertretender Vorsitzender Professor Dr. Dieter Feineis erinnerte an die verstorbenen Mitglieder des vergangenen Jahres. Über die Finanzlage des Vereins berichtete Kassier Albrecht Siedler. Archivdirektor Merz sagte in seinem Grußwort, die Beschäftigung mit dem Konzil von Trient bilde den Auftakt einer mehrjährigen intensiven Auseinandersetzung mit der Zeit der Konfessionalisierung. Prägende Ereignisse seien dabei das 500. Gedenken an die Reformation und der 400. Todestag von Fürstbischof Julius Echter im Jahr 2017.
bs (POW)
(4713/1173; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Foto abrufbar im Internet