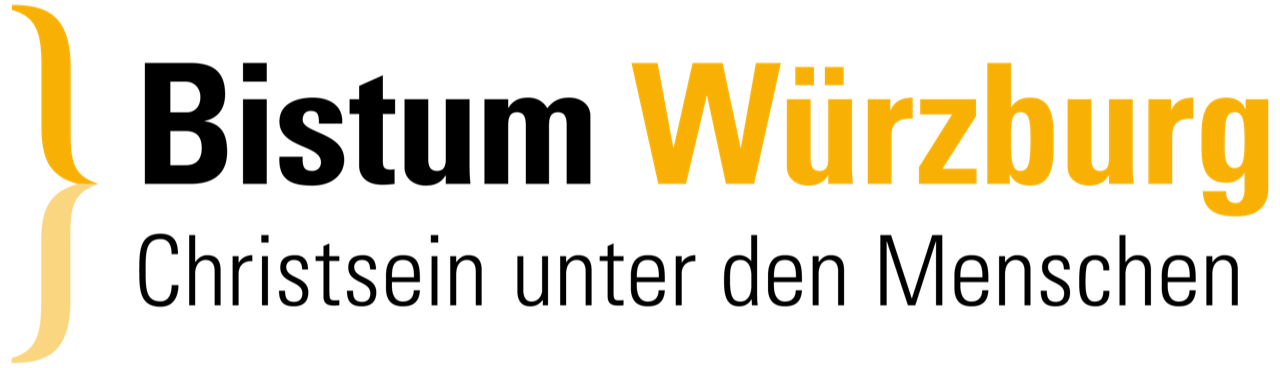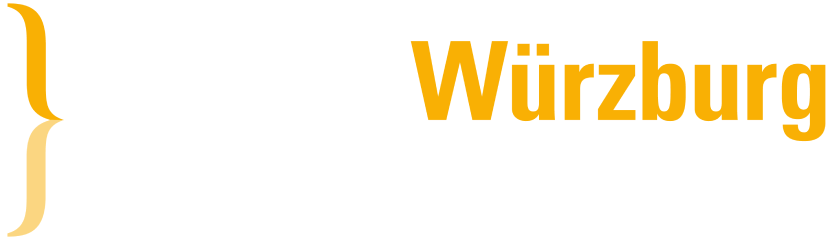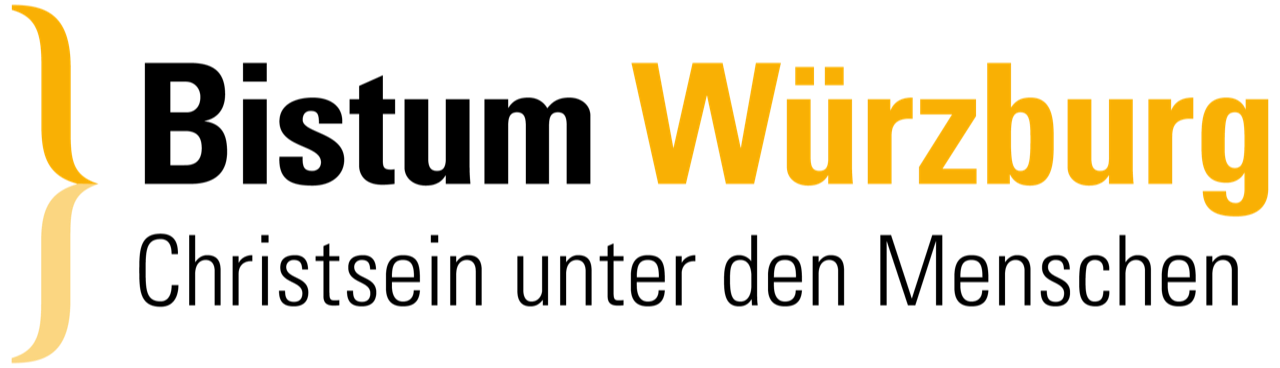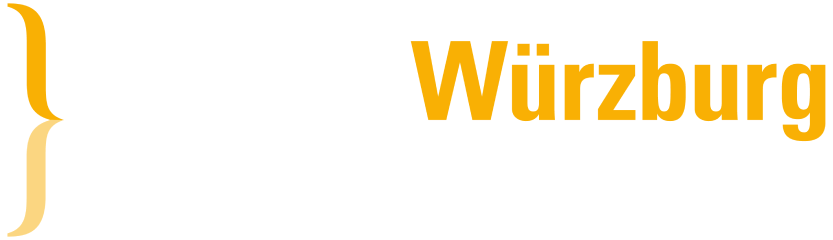Würzburg (POW) Dr. Stephan Steger (43) ist seit einem guten halben Jahr Liturgiereferent der Diözese Würzburg. In folgendem Interview nennt er die Schwerpunkte seiner Tätigkeit, erklärt den Begriff Liturgie und spricht über „heiße Eisen“ in der Liturgie.
POW: Herr Dr. Steger, zunächst waren Sie Referent für Liturgie und liturgische Bildung, seit 1. Februar 2009 sind Sie Liturgiereferent. Worin liegt der Unterschied zwischen beiden Aufgaben?
Dr. Stephan Steger: Dieser Titelwechsel, der beim ersten Lesen vielleicht etwas spitzfindig wirkt, hat seine Bedeutung tatsächlich eher im Kontext der Einbindung des Liturgiereferats in die diözesane Gesamtstruktur. Als Fachreferent für Liturgie und liturgische Bildung war ich sowohl Mitarbeiter von Weihbischof Helmut Bauer, der als Bischofsvikar für Liturgie diesen Bereich dem Bischof gegenüber verantwortete, als auch von Domkapitular Dr. Helmut Gabel, der als Direktor des Instituts für Theologisch-Pastorale Fortbildung die Fortbildung aller pastoraler Kräfte in unserem Bistum im Blick hat. Es ist sicher der Verdienst von Weihbischof Bauer, die Liturgie in unserem Bistum als zentrales Aufgabenfeld etabliert zu haben. Deshalb hat auch Bischof Dr. Friedhelm Hofmann mit dem 1. Februar 2009 die Verantwortung für den Bereich Liturgie und auch für die Kirchenmusik selbst übernommen, nachdem Weihbischof Bauer aus Altersgründen zum 31. Januar entpflichtet wurde. Somit bin ich als Liturgiereferent nun dem Bischof direkt zugeordnet ähnlich wie auch der Ökumenereferent, obwohl ich strukturell weiter in der Hauptabteilung „Außerschulische Bildung“ angegliedert bin.
POW: Wo liegen die Schwerpunkte der Tätigkeit eines Liturgiereferenten?
Steger: Die Tätigkeit des Liturgiereferenten gliedert sich in zwei Schwerpunkte. Die erste Aufgabe ist, Berater, Gutachter und Helfer des Bischofs, des Generalvikars und der ganzen Diözesanadministration im Bereich Liturgie zu sein. Aufgrund des starken Engagements von Bischof Hofmann umfasst das viele interessante Aufgaben im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz und der Weltkirche. So kann ich am neuen Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“ mitarbeiten und begleite auch die anderen Projekte zur Überarbeitung der liturgischen Bücher. Hinzu kommen viele Beratungen und Begleitungen auf Diözesanebene im Kontext der Errichtung von Pfarreiengemeinschaften. Schließlich erstellt das Liturgiereferat das diözesane Direktorium mit seinem liturgischen Jahreskalendarium und in Kooperation mit dem Referat Geistliches Leben die bistumsweite Textvorlage zur Fronleichnamsprozession.
POW: Und der zweite Schwerpunkt?
Steger: Die zweite Aufgabe liegt im Bereich der liturgischen Bildung. So trage ich die Verantwortung für die liturgische Aus- und Fortbildung der Priester und Diakone sowie der Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten. Endverantwortlich bin ich auch für die vielen ehrenamtlichen Dienste in der Liturgie, wie Gottesdienstbeauftragte, Kommunionhelfer und Lektoren. Das geht freilich nicht ohne Mitarbeiter. So bin ich mehr als dankbar mit Bernhard Hopf als Referenten für die Wort-Gottes-Feier und Monika Oestemer im Bereich der Fortbildung der Gemeindereferenten, bei der Erstellung des Direktoriums und der Textvorlage zur Fronleichnamsprozession tatkräftige und kompetente Unterstützung zu haben. Auch Klaus Simon als Referent für liturgisch-musikalische Bildung ist eine wertvolle Ergänzung unserer Arbeit. Letztendlich aber funktionieren unsere 180 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Jahr nur mit der Hilfe des Sekretariats der Hauptabteilung Außerschulische Bildung und der Diözesanbüros in den jeweiligen Regionen.
POW: Wie erklären Sie den Begriff Liturgie?
Steger: Liturgie ist in der westlichen Kirchentradition das Hören auf Gottes Wort und das gemeinschaftliche Antworten im Gebet. Wir können immer von gottesdienstlichem Handeln sprechen, wo Menschen zusammenkommen, Gottes Wort bedenken und im Gebet zu Gott rufen. Das geschieht allerdings in gestufter Relevanz für die Kirche selbst. Kirchenrechtlich wird als Liturgie all das bezeichnet, was durch die Weltkirche geordnet ist. Das betrifft neben der Feier der Messe die Sakramente, die übrigen Bischofsliturgien, die Stundenliturgie und die Begräbnisfeier. Daneben gibt es die diözesane Liturgie wie all unsere Wort-Gottes-Feiern und die Prozessionen. Und schließlich zählen auch alle Formen der „Volksfrömmigkeit“ wie Andachten, Rosenkranz, Kreuzweg und Wallfahrten zum Bereich zwischen römischer Liturgie und Privatfrömmigkeit.
POW: Das Thema Liturgie scheint zunehmend in der Kirche an Bedeutung zu gewinnen und die beiden anderen kirchlichen Grundvollzüge Glaubenszeugnis und karitatives Handeln zurückzudrängen. Wie beurteilen Sie die wachsende Bedeutung der Liturgie in der Kirche?
Steger: Ich hoffe nicht, dass die Glaubensverkündigung und das karitative Handeln durch die Liturgie in der Kirche zurückgedrängt werden. Das wäre fatal. Alle drei Bereiche gehören untrennbar zueinander. In der Liturgie findet die Glaubensverkündigung ihren besonderen und intensiven Vollzug. Karitatives Handeln erfährt seine Kraft und Energie durch die lebendige Gottesbegegnung in der Liturgie. Gleichzeitig werden die Nöte und Sorgen dieser Welt in der Liturgie vor Gott getragen und ihm anvertraut. Ich glaube, diese wichtige und im rechten Zusammenhang stehende Funktion der Liturgie ist nach den bewegten Zeiten der Liturgiereform Ende der 1970er Jahre etwas in den Hintergrund getreten. Und deshalb ist es sehr gut, dass eine Neubesinnung auf die Liturgie diese wichtige Aufgabe wieder ins Bewusstsein der Kirche treten lässt und neben der Qualität von Glaubensverkündigung und karitativem Engagement endlich auch die notwendige Qualität des liturgischen Geschehens thematisiert. Gleichzeitig darf es aber keine losgelöste Konzentration auf die Liturgie geben. Sie käme einer Flucht vor dem Verkündigungs- und Handlungsauftrag von Kirche in dieser Welt gleich.
POW: Welche „heiße Eisen“ gibt es derzeit in der Liturgie? Welche Fragen beschäftigen Sie derzeit am meisten?
Steger: Auch hier würde ich zwei Schwerpunkte benennen: So bringen zum einen die gesamtkirchlichen Überlegungen zu einer besseren – das heißt einer menschen- und inhaltsgerechteren – Feier der Liturgie einige Unsicherheiten vor Ort mit sich. Das betrifft zum Beispiel die Einführung des überarbeiteten Ritus‘ zur Feier der Kindertaufe oder die Feier der Beerdigung, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Von vielen werden auch die Veränderungen eines neuen Messbuchs und des neuen Gotteslobes kritisch oder hoffnungsvoll erwartet. Und schließlich bringt auch die päpstliche Öffnung zu einer innerkatholischen Ritenvielfalt ganz praktische und konkrete Fragestellungen mit sich. Zum anderen versuchen wir ganz stark die Vielfalt der Gottesdienstformen wieder in unsere katholisch-fränkische Tradition hinein zu etablieren. Das ist nicht nur aus liturgietheologischen Gründen wünschenswert. Es ist auch dringend notwendig, damit unsere vielen Kirchen vor Ort, die für die Lokalgemeinden nach wie vor Orte der Identifikation sind, auch Orte des Gebets und des gefeierten Glaubens bleiben.
POW: Selbst viele Katholiken wissen zunehmend immer weniger von Liturgie. Muss die Liturgie den Menschen wieder mehr erklärt werden? Welche Möglichkeiten sehen Sie hierfür?
Steger: Diese Beobachtung stimmt und sie stimmt auch nicht. Ich würde mir mehr wünschen, dass durch die bewusste Feier des Gottesdienstes und auch durch die Verkündigung, zum Beispiel durch eine liturgische Predigt, der Sinn der Liturgie den Mitfeiernden erschlossen werden kann. Ich erlebe aber gleichzeitig bei unseren vielen Kursen für Gottesdienstbeauftragte, Lektoren und Lektorinnen, Kommunionhelferinnen und -helfer eine Offenheit und eine Sehnsucht nach dem Wissen um liturgische Zusammenhänge und Hintergründe, was mich sehr hoffnungsvoll macht. Insofern werden wir unser Aus- und Fortbildungsangebot – so lange es geht – auf diesem hohen Niveau halten.
POW: Warum braucht der Mensch Liturgie?
Steger: Der Mensch ist ein soziales Wesen und deshalb lebt er in Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft braucht aber neben dem Alltag auch die Zeit des Feierns als verdichtete Form des Erlebens. Der Mensch als religiöses Wesen braucht somit auch die gefeierte Form des Glaubens als verdichtete Glaubenserfahrung. Theologisch gesagt braucht der Mensch die Liturgie, um Gott direkt begegnen zu können. Der direkte Dialog mit Gott in der Liturgie verdichtet und befruchtet all die vielen oftmals nur kleinen und indirekten Gottesbegegnungen und -erfahrungen im Alltag.
(3109/0880; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet