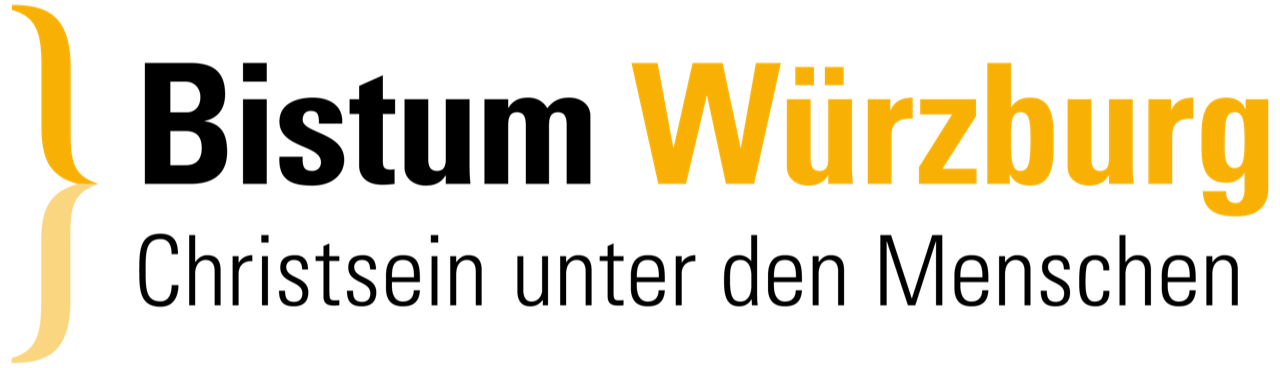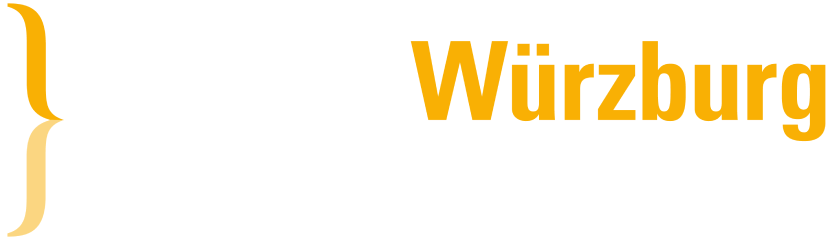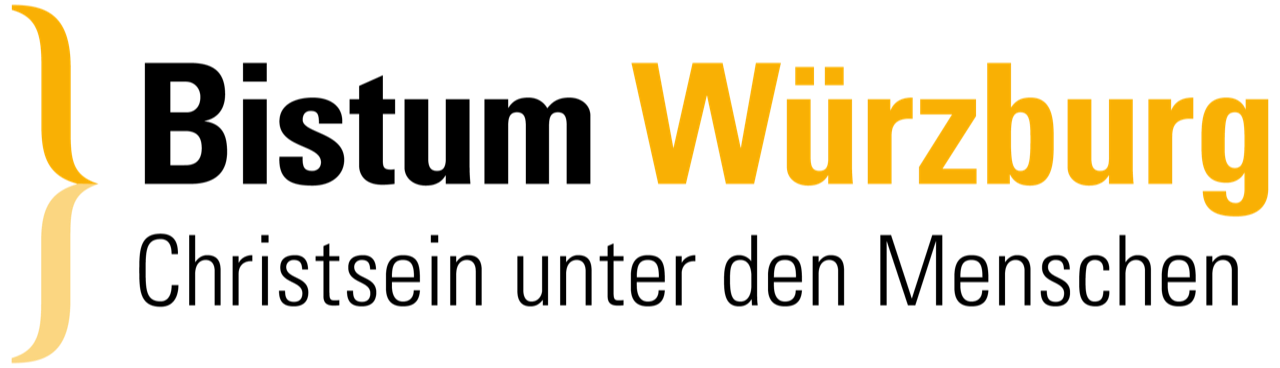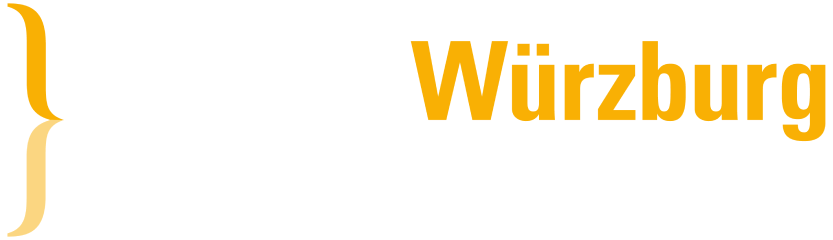Würzburg/Kiel (POW) Auslandseinsätze der Bundeswehr, Wehrpflicht und Wiedervereinigung: Das sind drei Themen, zu denen der Würzburger Diözesanpriester Militärdekan a. D. Peter Rafoth (70) nach fast 40 Jahren als Militärseelsorger aus seiner Perspektive etwas zu sagen hat. Im folgenden Interview spricht er außerdem über den Wandel der gesellschaftlichen Meinung zur Bundeswehr und über seine Aktivitäten im Ruhestand.
POW: Sie waren mehrere Jahrzehnte als Militärgeistlicher aktiv. Was hat Sie damals bewogen, auf diesem Gebiet der Seelsorge aktiv zu werden?
Prälat Peter Rafoth: Als im Sommer 1971 der damalige Generalvikar Justin Wittig mich als Kaplan von Kitzingen zu einem Personalgespräch in das von mir und anderen Kaplänen ängstlich gemiedene und locker verspottete Bischöfliche Ordinariat einbestellte, war ich total überrascht. Versetzungen wurden damals nicht mit den Betroffenen besprochen, sondern die feste endgültige Entscheidung nur brieflich autoritär mitgeteilt. Umso mehr war ich erstaunt, als der Generalvikar nach einigen Umschweifungen im Gespräch das Thema Militärseelsorge anschnitt.
POW: Hatten Sie vorher schon einmal dieses Gebiet der Seelsorge als Tätigkeitsfeld in Erwähnung gezogen?
Rafoth: Ich hatte keine Ahnung vom Militär. Selbstverständlich wurde ich einmal gemustert, aber nie eingezogen. Ich war bis dahin noch nie in meinem Leben in einer Kaserne gewesen und kannte auch keinen Soldaten etwas näher. „Ach, die Soldaten sind doch auch nur Menschen, junge Männer und Familienväter genau wie in unseren Pfarreien. Sie haben auch ihre alltäglichen Sorgen mit Getrenntsein von der Freundin oder Probleme in der Familie. Es ist einfach eine Seelsorge am Arbeitsplatz der Soldaten“, sagte der Generalvikar und erklärte mir, dass der Bruder unseres Bischofs sogar General sei. Den Begriff „kategoriale Seelsorge“ gab es damals noch nicht.
POW: Wie haben Sie sich in Ihre neue Tätigkeit eingearbeitet?
Rafoth: Ich begab mich in ein vorsichtiges Praktikum. Ich hospitierte bei erfahrenen, anerkannten und markanten Militärseelsorgern aus unserer Diözese wie Hartmut Wahl, Werner Köster, Theo Sell und Linus Eizenhöfer. Dann lernte ich erst einmal Soldaten in Veitshochheim, Hammelburg und Mellrichstadt kennen. Das gab mir Mut, meine erste offizielle Dienststelle in Göttingen anzutreten.
POW: Was unterscheidet die Militärseelsorge von der Pfarrseelsorge? Was sind die besonderen Nöte, mit denen Sie im Umgang mit den Soldaten konfrontiert worden sind?
Rafoth: Gerade in der liberalen, progressiven Universitätsstadt Göttingen tobten sich anfangs der 1970er Jahre die aufregenden Ideen der 1968er-Generation aus. Politische Demonstrationen waren an der Tagesordnung. Basisdemokratische Forderungen wurden täglich und lauthals ausgesprochen. Linke Kundgebungen machten gerade noch vor dem Kasernentor halt. Es gab starke intellektuelle Konfrontationen zwischen Studenten und Soldaten.
POW: Worum ging es dabei?
Rafoth: Heftige, nie enden wollende Debatten um Abrüstung wurden geführt. Hauptthema war der so genannte Nachrüstungsbeschluss, der besagte, dass die in Europa stationierten nuklearen Mittelstreckenraketen der NATO das Gleichgewicht der Abschreckung gegenüber der Sowjetunion wieder herstellen sollten. Und ich war doch jetzt Pfarrer und Seelsorger für die Soldaten! Ich wollte eigentlich nicht ständig über strategische Planspiele diskutieren. Hilfreich empfand ich das heute noch lesenswerte Friedenswort der deutschen Bischofe: „Gerechtigkeit schafft Frieden“. In diesen Jahren kam auch noch ein ideologischer Riss in unserer Kirche dazu. Es gab die Friedensfreunde beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), bei Pax Christi und den Kriegsdienstverweigerern. Andererseits sah die „Gemeinschaft Katholischer Soldaten“ in der Bundeswehr die einzige vernünftige, glaubwürdige Friedensinitiative der damaligen Zeit. Soldaten wurden zum Teil in den Schulen als kriegslüsterne Revanchisten diffamiert. Ich erinnere mich, als ein Hauptfeldwebel mir eine Tages erzählte, dass seine 13-jährige Tochter nach dem Unterricht nach Hause kam und zu ihrer Mutter sagte: „Ich wusste gar nicht, dass mein Papi einen solchen Sch…beruf hat.“ Unter solchen Spannungen hielt ich leidlich den so genannten „Lebenskundlichen Unterricht“ und Arbeitsgemeinschaften für Offiziere. Ich feierte Gottesdienste in Kasernen und auf Übungsplätzen, hielt Exerzitien und Werkwochen für Soldaten, organisierte Wallfahrten – nicht nur nach Lourdes – und versuchte stets, wohlgepflegte Vorurteile gegenüber der Kirche vernünftig zu entkräften.
POW: Waren Sie damit erfolgreich?
Rafoth: Große Bekehrungen sind mir nicht gelungen. Aber in Einzelgesprächen spürte ich das große Vertrauen, das junge Männer damals Vertretern der Kirche entgegenbrachten und das heute noch trägt.
POW: Vier Jahre lang waren Sie als Militärgeistlicher in Washington D.C. und an verschiedenen Standorten in den USA und in Kanada aktiv. An welche Begebenheiten aus dieser Zeit erinnern Sie sich besonders?
Rafoth: Meine Versetzung nach Washington 1976 forderte eine ganz neue Einstellung zur Militärseelsorge. Es gab in den USA fast keine größeren deutschen Truppenverbände. Die Eitelkeiten höherer Stabsoffiziere und das Elitedenken der dorthin Versetzten waren sofort spürbar. Ich war Pfarrer der Deutschen Gemeinde, Religionslehrer an der Deutschen Schule und besonders für 48 kleine militärische Dienststellen östlich des Mississippi zuständig. Ein wunderbarer, faszinierender pastoraler Wahnsinn! Natürlich kommt man dabei mit sehr interessanten Persönlichkeiten aus Politik, Journalismus, Wirtschaft und Kultur zusammen. Aber das weitere Erklimmen ihrer eigenen Karriereleiter war den meisten Herren wichtiger als der Herrgott.
POW: Wie ging es beruflich für Sie nach der Rückkehr nach Deutschland weiter?
Rafoth: Nach einem kurzen Zwischenspiel auf der Hardthöhe in Bonn kam ich 1982 nach München. Ich erhielt den Auftrag, als dienstaufsichtsführender Dekan die Soldatenseelsorge in Bayern zu organisieren. Es war für mich schön, Soldaten im Saft liebevoll gepflegter Traditionen und unangefochtener Privilegien anzutreffen. Die Soldaten fühlten sich als „Verteidigungsbeamte“, waren nach Feierabend zuhause und genossen fast immer ein freies Wochenende. Doch diese ldylle begann sich allmählich einzutrüben. Die herzliche Beheimatung und selbstverständliche Bejahung des Dienstes der Soldaten und später auch der jungen Frauen wurden immer unverbindlicher und fragwürdiger. Dazu kamen auch noch die Folgen der deutschen Wiedervereinigung. Soldaten der ehemaligen Nationalen Volksarmee mussten integriert werden. Plötzlich hatten Sachsen, Brandenburger und Soldaten aus Vorpommern Führungspositionen in bayerischen Garnisonen.
POW: Wie haben diese Menschen, die in einem atheistisch geprägten Land aufgewachsen sind, auf Sie als Militärgeistlichen reagiert?
Rafoth: Ich habe nie erlebt, dass ein von der Bundeswehr übernommener NVA-Soldat sich gegen unsere Militärseelsorge ausgesprochen hätte. Manchmal marschierten sie bei der Fronleichnamsprozession demonstrativ hinter dem Allerheiligsten. Aber fremd blieb ihnen diese „Organisation“ schon.
POW: Können Sie uns ein Beispiel dafür geben?
Rafoth: Auf einem Truppenübungsplatz sollte ein Gottesdienst stattfinden. Die Kompanie war fast vollzählig angetreten. Der Spieß schärfte den Soldaten kurz nochmals ein, dass der Pfarrer nun predigen würde und absolute Ruhe und keine Störung auftreten dürfe. Der Militärpfarrer begann also den Gottesdienst „Im Namen des Vaters ... – Der Herr sei mit euch!“ Darauf piepsten zwei Rekruten: „… und mit deinem Geiste!“ Der Spieß schrie empört: „Ruhe! Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr still sein sollt?!“ Diese Fremdheit spürte ich noch deutlicher in der norddeutschen Diaspora. Ich bekam inzwischen den Auftrag, Brücken zwischen Ost und West zu bauen. Von Kiel aus sollte ich für die Militärseelsorge Wege finden zwischen Ost und West, zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und zusammen mit der deutschen Marine die norddeutsche Militärseelsorge organisieren. Der Ruf nach Gottesdienst und Sakramentenspendung wurde immer leiser. Dafür fühlten sich unsere Pfarrer umso häufiger nur als Leiter einer Sozialstation. Dank des Zölibats habe ich Zeit. Die Soldaten brauchen oft einfach jemanden, der ihnen zuhört, wenn sie ein Problem haben. Zum Beispiel, dass Frau und Familie so weit weg sind, sie vielleicht verschuldet sind oder ähnliches.
POW: Seit 1992 führt die Bundeswehr Auslandseinsätze durch. Wie hat sich dadurch die Militärseelsorge geändert?
Rafoth: Inzwischen haben sich innere und äußere Struktur der Bundeswehr total verändert. Aus einer Verteidigungsarmee ist eine Interventionstruppe für Einsätze „out of area“ geworden. Deutschland solle am Hindukusch verteidigt werden. Unsere Militärpfarrer waren sich immer im Klaren, dass sie ihre Schutzbefohlenen nicht alleine lassen dürfen. Wenn es unsere politischen Vertreter demokratisch verantworten können, junge Frauen und Männer von Somalia bis Afghanistan einzusetzen, wird auch die Kirche die Soldaten bei diesen gefährlichen Einsätzen begleiten. Dort sind die Pfarrer den Soldatinnen und Soldaten bei Tag und Nacht ganz nahe. Sie erleben hautnah Tod und Verwundung, Trennung und Scheidung bei den Familien und posttraumatische Belastungsstörungen. Sie geben ethische Hilfen in den schwierigen, verantwortungsvollen Fragen des Umgangs mit im Grunde todbringenden Waffen. Kurz gesagt: Noch nie war die Militärseelsorge so anerkannt wie heute.
POW: Wie beurteilen Sie den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr?
Rafoth: Wir erleben in Afghanistan einen sogenannten asymmetrischen Krieg. Taliban ohne Uniform, als Bauer oder Bettler verkleidet, sind bereit, sich und ihre Umgebung im nächsten Augenblick als Selbstmordattentäter in die Luft zu sprengen. Dazu heißt es in den Richtlinien der Bundeswehrführung: „Direkte Angriffe auf Personen sind auf Situationen unmittelbarer Notwehr zu beschränken. Feindselige Akte sollten sich ansonsten gegen Sachen richten.“ Wenn also ein Soldat aus Angst oder Aufregung auf einen aggressiven Angreifer schießt, erwartet ihn zuhause der Staatsanwalt. Kein Staatsanwalt kümmert sich aber um die reichlich wogenden Mohnfelder. Hier erwachsen den Taliban riesige Geschäfte mit Drogen für den Westen. Somit finanzieren westliche Junkies und Fixer neueste Waffen gegen westliche Soldaten. Also, Augen zu! Wer steht also den Soldaten im Einsatz bei ethischen Problemen bei? Der Truppenpsychologe – ja! Und der frei von militärischer Befehlsgewalt begleitende Militärseelsorger – ganz bestimmt!
POW: Hat die Wehrpflicht in Ihren Augen noch eine Zukunft?
Rafoth: Die Wehrpflicht wird nicht nur ausgesetzt werden; sie wird fallen. Das ist zu bedauern, aber wird eine politische Entscheidung herausfordern, die von Finanzen und Sicherheitskomponenten geprägt wird. Damit verkleinern sich die Bundeswehr und damit auch die Zahl der Militärgeistlichen. Diese werden dann hauptsächlich im Ausland eingesetzt werden. Es bleibt dann noch die Frage, wer sich um die zurückgebliebenen Familienangehörigen kümmert. Die jetzt schon überforderten Ortsseelsorger werden es nicht schaffen. Noch gibt es ein paar in die Jahre gekommene, pensionierte Militärdekane, die sich weiter engagieren.
POW: Sie helfen heute im von der Diaspora geprägten Erzbistum Hamburg und im Nato-Hauptquartier in Neapel in der Seelsorge. Wie stark ist der Unterschied zwischen dem auch klimatisch kühleren Norden und der Arbeit im katholischen Italien?
Rafoth: Zunächst ist einmal festzuhalten, dass die deutsche Militärgemeinde in Neapel eine eigene kleine Einheit ist, die von der italienischen Volkskirche um sie herum nicht viel mitbekommt. Es ist schön, dort zu leben, auch wenn man erfährt, dass die Mafia überall präsent ist. Einem Bekannten haben sie in Neapel Computer und Auto geklaut, während er zuhause war. Was meine Mitarbeit in Hamburg angeht: Wir haben einen sehr guten Bischof und eine sehr gute Verwaltung, die allesamt nahe dran sind an den Menschen. In der Marine finden Sie viele Süddeutsche, daher sind dort auch deutlich mehr Katholiken vertreten als im sonst stark protestantisch geprägten Diasporabistum. Die wenigen Katholiken, die es gibt, sind aber sehr gut vernetzt und oft stark engagiert.
POW: Zu ihren „Hobbies“ gehört, dass sie Kreuzfahrtschiffe begleiten. Welche Erfahrungen machen Sie dabei?
Rafoth: Kiel ist der zentrale Ort für Kreuzfahrten auf der Ostsee, weil er bestens via Autobahn erreicht werden kann. Daher kommen Menschen aus ganz Deutschland dorthin. Sie staunen dann nicht schlecht, wenn sie an Bord plötzlich einem Pfarrer begegnen. Normalerweise biete ich jeden Tag eine Morgenandacht an. Sonntags feiern wir selbstverständlich die heilige Messe. Dazu gibt es viele Möglichkeiten der unkonventionellen Kontaktaufnahme und Gespräche. Meist haben sie wenig oder nichts mit der Kirche zu tun. Und nach einiger Zeit kommen sie dann auf mich zu: „Was ich schon immer mal einen Pfarrer fragen wollte…“
POW: Welche Fragen kommen denn dann?
Rafoth: Die Fragen erstrecken sich von A wie Ablass, bis Z wie Zölibat. Da ist zum Beispiel auch das ungetaufte Rentnerehepaar aus der DDR, das sein goldenes Ehejubiläum begeht und sich für das Fest an Bord einen Segen durch den Pfarrer wünscht. Das mache ich dann gerne, weil ich gerne Vorurteile gegenüber der Kirche aus dem Weg räume. „Die Katholiken sind ja gar nicht so schlimm wie wir immer gedacht haben“, ist einer der Sätze, die ich bei solchen Gelegenheiten immer wieder höre. (schmunzelt)
Zur Person:
Peter Rafoth (70) wurde 1940 in Offenbach (Bistum Mainz) geboren. Nach dem Studium der Theologie wurde er am 27. Juni 1965 in Würzburg zum Priester geweiht. Anschließend wirkte er als Kaplan in Sulzbach, Kirchlauter und Kitzingen-Sankt Johannes. 1971 wurde er für die Militärseelsorge freigestellt. 1972 kam er nach Göttingen, 1976 nach Washington D.C. 1980 wurde Rafoth zum Miltärdekan ernannt und wechselte nach Bonn. 1981 wurde er zudem Stellvertretender katholischer Wehrbereichsdekan III. 1982 ging er als Wehrbereichsdekan VI nach München. 1986 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Monsignore, 1996 zum Päpstlichen Ehrenprälat. 1997 ging Rafoth nach Kiel, wo er als Wehrbereichsdekan I dienstaufsichtsführender Dekan für Soldaten in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern war und ab 2002 zusätzlich für die Deutsche Marine beauftragt war. Zum 16. September 2003 wurde er freigestellt für den Dienst in der Erzdiözese Hamburg und die Militärseelsorge beim NATO-Hauptquartier in Neapel/Italien.
(3810/1151; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet