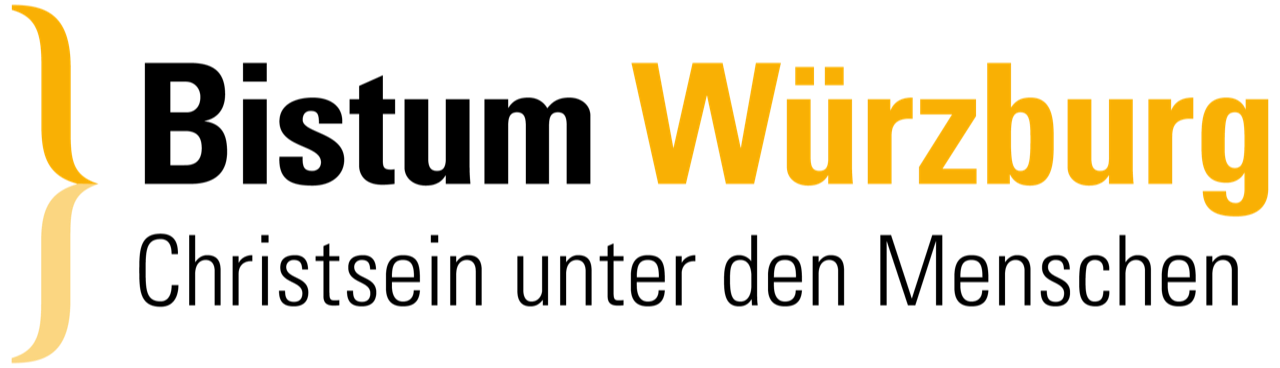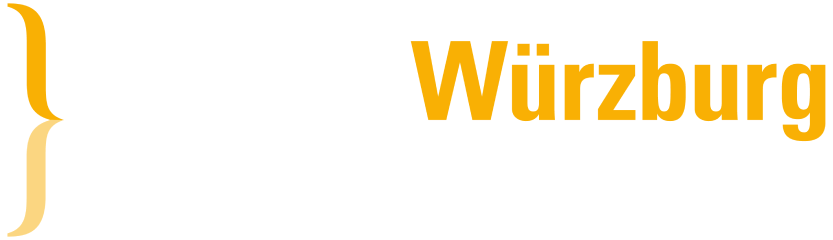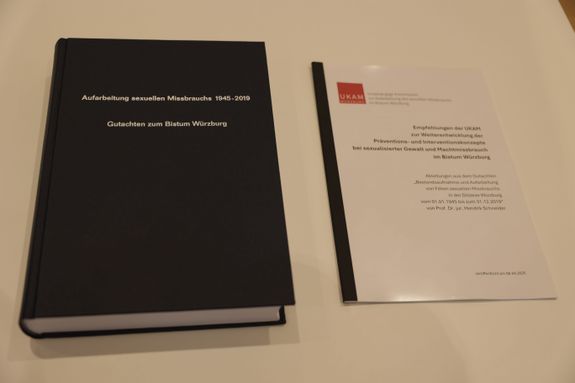(POW)
"Teil 1 – Bischof Dr. Franz Jung – Stellungnahme zum UKAM-Gutachten
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Pressekonferenz, in der ich als Bischof von Würzburg eine erste Einschätzung zum Gutachten gebe, das Professor Dr. Schneider im Auftrag der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Würzburg“ – kurz UKAM – erarbeitet hat und das mir am vergangenen Dienstag überreicht wurde.
Wenn ich recht sehe, handelt es sich um das erste Gutachten, das nicht von einem Bistum beauftragt wurde, sondern von der Unabhängigen Kommission, die auch das Forschungsdesign der Studie in Abstimmung mit dem Betroffenenbeirat vorgegeben hat. Als Bischof habe ich immer gesagt, dass wir mit der Aufarbeitung erst beginnen, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen, die in der gemeinsamen Erklärung zwischen der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem UBSKM – dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen sexuellen Kindesmissbrauch – 2020 vereinbart wurden. Diese waren ein arbeitsfähiger Betroffenenbeirat und eine unabhängige Aufarbeitungskommission. Ich bin froh und dankbar, dass es gelungen ist, beide Gremien für das Bistum Würzburg zu etablieren. Dieser Vorlauf jedoch bedingte, dass wir etwas später gestartet sind mit der Aufarbeitung, die völlig unabhängig sein sollte.
Ausdrücklich danke ich heute den Mitgliedern beider Gremien für die intensive und aufreibende Arbeit der vergangenen Jahre. Mit der Veröffentlichung des Gutachtens treten wir ein in eine neue Phase der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in unserem Bistum. Mein Dank geht natürlich auch an Professor Dr. Schneider und sein Team für die Erstellung des akribisch erarbeiteten Gutachtens.
Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich vorab klären, was Sie heute nicht erwarten können:
• Fragen zum Forschungsdesign des Gutachtens, den abzuarbeitenden Fragestellungen und den getroffenen Definitionen sind an die UKAM bzw. Professor Dr. Schneider zu richten und von beiden auch zu verantworten.
• Auch Fragen zu einzelne Missbrauchsfällen können im Rahmen dieser Pressekonferenz aus Datenschutzgründen nicht erörtert werden.
• Ebenso wenig wird der Missbrauch an erwachsenen Personen thematisiert und Missbrauchsfälle, die sich in Ordensgemeinschaften ereignet haben, selbst wenn sich diese auf dem Gebiet des Bistums Würzburg befunden haben oder noch befinden. Beides war nicht Teil des Auftrags, der in der gemeinsamen Erklärung zwischen UBSKM und DBK vereinbart wurde.
Was aber erwartet Sie heute?
• Ich möchte zu Beginn eine Einordnung des Gutachtens aus meiner Sicht geben
• In einem zweiten Punkt wird Frau Pfeil darüber informieren, wie das Bistum die Aktenbestände aufbereitet hat und wem sie zugeleitet wurden zur Begutachtung
• In einem dritten Punkt legt Frau Schüller dar, welche Konsequenzen aus dem Gutachten für die Intervention zu ziehen sind
• In einem vierten Punkt wird Generalvikar Dr. Vorndran erläutern, was das Gutachten bedeutet für die Weiterentwicklung von Prävention in unserem Bistum
• Zum Abschluss werde ich einen Ausblick geben auf die nächsten Schritte, die in der Arbeit mit dem Gutachten anstehen, das ja keinen Endpunkt darstellt, sondern einen Meilenstein für unser Bemühen bildet, uns „Gemeinsam für eine sichere Kirche“ stark zu machen
So komme ich zu meinem ersten Punkt, einer ersten Einordnung des Gutachtens. Keine Aufarbeitung, ohne das Leid der Betroffenen vor Augen zu stellen, gerade nach den Jahren des Verdrängens, des Verschweigens und des Vertuschens. Die Wahrnehmung des zugefügten Leids sind wir den Betroffenen schuldig. Das Ausmaß ist erschreckend, auch im Bistum Würzburg.
Das Gutachten identifiziert 51 Beschuldigte, erheblich weniger als die MHG Studie im Jahr 2018. Im Gegensatz dazu aber wird die Zahl der Betroffenen deutlich nach oben korrigiert. Das Gutachten spricht jetzt von 226 Betroffenen. Noch bedrückender wird es, wenn es um die Anzahl der Übergriffe geht. Das Gutachten konnte 449 Taten an den 226 Betroffenen nachweisen. Da es aber unter den 51 Beschuldigten etliche Mehrfachtäter gibt, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg an den Betroffenen vergangen haben, kommen die Gutachter zu der furchtbaren Zahl von 3053 Übergriffen. Ein unvorstellbares Ausmaß.
Zu den Missbrauch-begünstigenden Faktoren zählt das Gutachten:
• Asymmetrische Machtverhältnisse, die zu Amtsmissbrauch einluden
• Abhängigkeitsverhältnisse, die zur Unterwerfung führten
• Unhinterfragte Autorität, die keinen Verdacht zuließ und duldete
• Die Unantastbarkeit der Amtsträger, die die „Definitionsmacht“ für sich beanspruchten über das, was sie anderen antaten, und ihre Verbrechen immer wieder schönredeten und damit auch noch Erfolg hatten
• Eine gesellschaftliche Stellung kirchlicher Amtsträger, die im weiteren Umfeld und noch darüber hinaus Respekt einfordern konnte und der man sich auch willig unterordnete
Das Gutachten lässt aber auch keinen Zweifel am schuldhaften Versagen der kirchlichen Verantwortungsträger. Wäre rechtzeitig eingeschritten worden und wäre man den vorliegenden Hinweisen auf Missbrauch konsequent nachgegangen, hätten wahrscheinlich viele Übergriffe verhindert werden können.
Warum das nicht passiert ist, wird auch im Gutachten in bedrückender Weise dargelegt:
• Einschüchterung der Betroffenen durch die bischöfliche Behörde oder durch ihr unmittelbares Umfeld, in dem sie sich nicht trauten, vom Missbrauch zu erzählen – wie oft ist die Rede davon, dass sich Gemeindemitglieder empört gegen den Bischof und das Ordinariat wandten, wenn der Beschuldigte versetzt oder seine Untaten ansatzweise geahndet wurden
• Deckung der Täter durch die Verantwortungsträger des Bistums wider besseres Wissen bei Hochhalten des priesterlichen Standesethos
• Versetzung der Beschuldigten, auch in andere Bistümer, und Verschleierung der wahren Gründe für eine Versetzung
• Bemühungen, festgesetzte Strafmaße herab- oder auszusetzen
• Inkonsequentes Verfolgen der Übergriffe sexualisierter Gewalt mit Absichtserklärungen gegenüber den Betroffenen und ihren Familien, die aber nie eingelöst, und mit Zusagen, die immer wieder gebrochen wurden
• Durch Untätigkeit herbeigeführte Fristverschleppungen, die eine Nachverfolgung der Übergriffe juristisch und kirchenrechtlich unmöglich machten
• Nachlässig oder chaotisch gehandhabte Dokumentations- und Meldepflichten, die erkennen lassen, dass man noch immer nicht gelernt hatte, dass keine Zeit zu verlieren ist, um schwerstes Leid von schutzbedürftigen Personen abzuwenden oder zu verhindern
Eine verheerende Bilanz. Sie zeigt immer wieder aufs Neue, dass in den Augen der Verantwortungsträger der Schutz der Institution und die Sorge um das priesterliche Ansehen des Täters Vorrang hatten. Das Wohl der Kinder oder der Betroffenen kam, wenn überhaupt, nur sehr unzureichend in den Blick.
Das ist beschämend und erschütternd zugleich.
So möchte ich heute meine Bitte um Entschuldigung für die Jahre des Schweigens, der Verleugnung und der Untätigkeit erneuern, die ich schon bei der Entgegennahme des Gutachtens geäußert habe. Und ich muss erneut hinzufügen, wie sehr mir bewusst ist, dass viele dieser Bitte aus gutem Grund nicht werden nachkommen können.
In den vergangenen Tagen hatte ich ein längeres Gespräch mit meinem Vorgänger im Amt, Bischof emeritus Dr. Friedhelm Hofmann. Nach der Lektüre des Gutachtens und im Rückblick auf seine Amtszeit bat er mich, am heutigen Tag in seinem Namen folgende Erklärung vorzutragen:
„Das Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Bistum Würzburg betrifft auch meine Amtszeit als Bischof von Würzburg in den Jahren von 2004 bis 2017. Nach der eingehenden Lektüre des Gutachtens muss ich selbstkritisch einräumen, dass in meiner Zeit als Bischof von Würzburg Fehler gemacht wurden bei der Bearbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs. Ich weiß, dass ich als Diözesanbischof immer die Letztverantwortung getragen habe, auch wenn ich im Einzelnen den Umgang mit den Fällen sexualisierter Gewalt meinem jeweiligen Generalvikar anvertraut habe. Für die Fälle, in denen Betroffenen kein ausreichendes Gehör geschenkt wurde, Hinweisen zu Übergriffen nicht schnell genug nachgegangen wurde und Täter nicht konsequent genug zur Rechenschaft gezogen wurden, bitte ich ausdrücklich um Entschuldigung. Ich bedaure das sehr und weiß heute, dass ich hier als Bischof mehr gefordert gewesen wäre und hinter meiner Verantwortung zurückgeblieben bin.“
Neben Bischof Hofmann wurde ich auch gebeten, im Namen von Domkapitular emeritus Dr. Heinz Geist heute zu sprechen. Dr. Geist war von den Jahren 1997 bis 2010 Personalchef sowie von 2002 bis 2010 Missbrauchsbeauftragter des Bistums Würzburg. Er hat mir folgende Erklärung übermittelt mit der Bitte um Verlesung in der heutigen Pressekonferenz:
„Das Gutachten vom 8. April 2025 dokumentiert für die Dauer meiner Zeit als Missbrauchsbeauftragter ein nicht immer den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz vom 26. September 2002 entsprechendes Vorgehen in den mir gemeldeten Fällen.
Ich bedauere dies.
Ich stelle mich der Verantwortung für diese Versäumnisse und verzichte als Konsequenz auf meine Mitgliedschaft im Domkapitel zu Würzburg, auf die Zelebration öffentlicher Gottesdienste wie auf pastorale Veröffentlichungen.“
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Missbrauch bleibt eine offene Wunde, die nicht heilt, weil noch immer Menschen unter den Folgen dessen leiden, was ihnen im Raum der Kirche angetan wurde. Eine offene Wunde sensibilisiert für die Schmerzen und zwingt zu einem vorsichtigen und vorausschauenden Umgang.
In diesem Sinn habe ich als Bischof von Beginn meiner Amtszeit an das direkte Gespräch mit den Betroffenen gesucht. Das mutige Zeugnis der Betroffenen hat es uns überhaupt erst möglich gemacht, den Prozess der Aufarbeitung anzugehen.
Ausdrücklich danke ich Ihnen, Frau Göbel, sowie Frau Dr. Zehtner und Herrn Amrhein für ihre Arbeit im Betroffenenbeirat. In unseren Begegnungen haben Sie mir mitgeteilt, wie belastend diese Tätigkeit für sie war und ist. Umso dankbarer bin ich, dass dieses wichtige Projekt jetzt zu einem Abschluss gebracht werden konnte, der einen Meilenstein darstellt bei unseren Bemühungen um eine sichere Kirche.
Als Bistum haben wir Betroffene – soweit sie es wollten – begleitet bei der Antragstellung im Rahmen des erweiterten Verfahrens zur Anerkennung des Leids, das im Jahr 2021 auf den Weg gebracht wurde. Wir haben Betroffene ebenso begleitet bei der seit 2023 bestehenden Möglichkeit, Widerspruch einzulegen gegen Leistungsentscheidungen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen in Bonn und um eine neuerliche Überprüfung nachzusuchen. Ebenso haben wir Betroffenen Begleitung angeboten, wenn sie nach Vorlage neuer Informationen um eine erneute Antragstellung gebeten haben. Uns ist wichtig, niemanden allein zu lassen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
das Thema sexueller Missbrauch ist mit dem nun vorliegenden Gutachten für uns nicht erledigt. Ich sage das ausdrücklich, weil ich immer wieder höre, mit dem Gutachten sollten wir nun endlich einen Schlussstrich ziehen und das leidige Thema auf sich beruhen lassen. Das wird nicht geschehen. Welche Anstrengungen wir unternehmen, um Missbrauch künftig zu verhindern, möchten wir Ihnen im Folgenden darlegen.
Das Leid der Betroffenen ist dokumentiert in den Akten, die wir seit 2018 aus den unterschiedlichsten Ablageorten zusammengeführt haben, um sie zu sichten und sie externer Begutachtung zuzuführen. Was wir gemacht haben und wie wir dabei vorgegangen sind, wird Ihnen jetzt Frau Ordinariatsrätin Kathrin Pfeil erläutern.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Teil 2 – Ordinariatsrätin Kathrin Pfeil – Aktenaufbereitung und Übermittlung zur Begutachtung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf im Überblick zentrale Schritte der Aufarbeitung und rechtlichen Klärung von Verdachtsfällen nennen, die wir seit 2018 gegangen sind. Diese bildeten wiederum die Grundlage für die unabhängige Aufarbeitung durch Professor Dr. Schneider.
Für die Erstellung der MHG-Studie wurde beim größeren Teil der Bistümer – darunter auch Würzburg – Personalakten für den Zeitraum 2000 bis 2015 sowie die Dokumente aus dem in dieser Zeit bestehenden Geheimarchiv seit 1945 untersucht. Bischof Dr. Jung hat nach seinem Amtsantritt 2018 entschieden, in Ergänzung dazu auch Personalakten seit 1945 nach den Vorgaben der MHG-Studie zu untersuchen. Das Ergebnis dieser Folgestudie wurde im Jahr 2019 vorgestellt. Sie können das im Gutachten von Professor Dr. Schneider ab S. 131 detailliert nachvollziehen.
Ebenfalls im Jahr 2019 wurde eine Untersuchung für die drei „Kilianeen“ in Würzburg, Miltenberg und Bad Königshofen vorgestellt, die im Wesentlichen Fälle körperlicher Gewalt in den Knabenseminaren dokumentierte.
Im Zuge dieser Erhebungen, insbesondere der MHG-Studie, wurden somit alle verfügbaren Personalakten von Klerikern seit 1945 systematisch auf Hinweise auf sexualisierte Gewalt durchgesehen. Diese Prüfungen wurden durch externe Anwaltskanzleien durchgeführt. Ein Ergebnis ist jener Aktenbestand, der nun auch der unabhängigen Untersuchung von Professor Dr. Schneider zugrunde lag.
Alle genannten Akten mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt wurden in den Jahren 2018 und 2019 der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg zur Prüfung vorgelegt. Im Sinne einer transparenten Aufklärung hatte das Bistum Würzburg dabei auch solche Fälle vorgelegt, bei denen die Tat unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit lag. Im Ergebnis wurden die weitaus meisten Fälle von den Staatsanwaltschaften umgehend geschlossen und nicht weiterverfolgt.
In der jüngeren Vergangenheit richtete sich eine größere Aufmerksamkeit auf das Handeln von Verantwortlichen im Zusammenhang mit Missbrauchstaten. Um auch diese Frage zu überprüfen, haben wir im Jahr 2022 der Generalstaatsanwaltschaft erneut eine große Zahl von Akten vorgelegt, insbesondere die Akten von verstorbenen Beschuldigten. Wir wollten damit auch mögliches strafbares Fehlverhalten von Verantwortungsträgern ermitteln lassen in Fällen, bei denen dies zuvor nicht in Betracht gezogen worden war. Auch diese Übersendung führte zu keinen weiteren Erkenntnissen.
Schließlich haben wir ebenfalls im Jahr 2022 in einem sehr umfangreichen Versand eine größere Zahl von Akten an das für Missbrauchsfälle zuständige Glaubensdikasterium nach Rom übergeben. Hinsichtlich des Umgangs der Kurienbehörde mit Fällen sexualisierter Gewalt darf ich Sie auf die Darstellung im Gutachten von Professor Dr. Schneider ab S. 250 hinweisen. Diese findet auch in den Handlungsempfehlungen der UKAM Niederschlag.
Im Ergebnis betone ich drei Feststellungen:
1. Mit unserer systematischen Durchsicht der Personalakten nach Hinweisen auf sexualisierte Gewalt konnten wir einen Aktenbestand schaffen, der die ermittelbaren Fälle bestmöglich abbildet.
2. Wir konnten damit zugleich einen Aktenbestand schaffen, der auch den Ansprüchen einer unabhängigen Aufarbeitung durch die UKAM genügte. Selbstverständlich werden wir Empfehlungen zur Weiterentwicklung in diesem Bereich konstruktiv aufgreifen.
3. Sämtliche uns bekannten Hinweise auf sexualisierte Gewalt wurden – zum Teil mehrfach – durch staatliche wie kirchliche Behörden geprüft.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Teil 3 – Kerstin Schüller – Konsequenzen für die Interventionsarbeit
Sehr geehrter Damen und Herren,
als Leiterin der Stabsstelle Prävention und Intervention bin ich für die drei Themen Prävention, Intervention und Aufarbeitung verantwortlich.
Für die Aufarbeitung ist das von der UKAM in Auftrag gegebene Gutachten der zentrale Baustein, sowohl zur Einschätzung unseres Handelns in konkreten Fällen, als auch zur Weiterentwicklung unseres Vorgehens.
Durch das Gutachten haben wir neue Informationen zu einem Fall erhalten, die uns bislang nicht bekannt waren. Diese Informationen entstammen einer Strafakte, die der Gutachter im Zuge der Recherchen eingesehen hatte. Wir werden diesen neuen Informationen gemäß unseres Interventionsverfahrens nachgehen. Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung des Gutachtens haben wir daher bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Einsicht in die Ermittlungsakte beantragt.
Wir werden auch die weiteren im Gutachten behandelten Fallbeispiele intensiv studieren. Sofern sich daraus neue Informationen ergeben, werden wir diesen konsequent nachgehen.
Für das Gutachten hatte die UKAM den Auftrag erteilt, Fälle mit einem „hinreichenden Tatverdacht“ auf sexualisierte Gewalt zu ermitteln. Es handelt sich hierbei um eine juristisch gut begründete, aber relativ enge Definition.
Ich möchte betonen, dass unserer Präventions- und Interventionsarbeit ein deutlich weiter gefasster Begriff zugrunde liegt. Wir haben das Ziel, eine sichere Kirche für alle Menschen zu sein. Unsere Nulltoleranz-Politik greift daher nicht erst bei Straftaten, sondern bei jeder sexualisierten Grenzverletzung – auch dann, wenn diese unterhalb der Grenze der Strafbarkeit liegt.
Entsprechend verpflichtet unsere Interventionsordnung alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen dazu, jeden Verdacht auf sexualisiertes Fehlverhalten im dienstlichen Kontext unverzüglich zu melden – unabhängig davon, ob es sich um strafbares Verhalten handelt. Auch anonymen Meldungen wird nachgegangen.
Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Interventionsarbeit ist die Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Polizei. Jeder Verdacht auf ein entsprechendes Fehlverhalten wird konsequent an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Das Bistum nimmt hierbei keine eigene strafrechtliche Einordnung vor. Nur durch dieses transparente Vorgehen können wir sicherstellen, dass eine Vertuschung von Straftaten nicht möglich ist.
Ohne einen konsequenten und transparenten Umgang mit Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt ist keine nachhaltige Aufarbeitung möglich.
In den zurückliegenden Jahren wurde das Interventionsverfahren kontinuierlich weiterentwickelt. Wir beziehen heute Betroffene entsprechend ihrer Bedarfe aktiv in den Interventionsprozess ein. Zudem hat die traumasensible Begleitung von Betroffenen in unseren Verfahren eine hohe Bedeutung.
Bei allen Fortschritten ist uns bewusst, dass auch in diesem Bereich Evaluation und Anpassungen notwendig sind, um die Nachhaltigkeit unserer Arbeit sicherzustellen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Teil 4 – Generalvikar Dr. Jürgen Vorndran – Auf dem Weg zur sicheren Kirche: Prävention im Bistum systematisch stärken
Neben der Interventionsarbeit haben wir in den vergangenen Jahren unsere Anstrengungen im Bereich der Prävention stetig verbessert. Im Jahr 2013 nahm Schwester Dagmar Fasel von den Missionsdominikanerinnen in Neustadt am Main als erste Präventionsbeauftragte im Bistum Würzburg ihre Arbeit auf.
In der Folge haben wir erkannt, dass es einer eigenen Interventionsbeauftragten bedarf. Diese neu geschaffene Stelle ist seit 1. Juli 2022 mit Frau Kerstin Schüller kompetent besetzt. Als eines der ersten Bistümer in Deutschland haben wir Prävention und Intervention gemeinsam in einer Stabsstelle zusammengeführt und mit 3,5 Vollzeitstellen ausgestattet.
Daneben leisten 54 Präventionsberaterinnen und -berater in den 43 Pastoralen Räumen wichtige Sensibilisierungsarbeit vor Ort. Diese engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten auf die konkreten Umstände des jeweiligen Bereichs angepasste Angebote auf einem hohen Niveau. Für die Qualität unserer Präventionsarbeit spricht nicht zuletzt die steigende Nachfrage nach Schulungen auch von nichtkirchlichen Organisationen.
In den Monaten Februar und März haben die Interventionsbeauftragte Kerstin Schüller, der Präventionsbeauftragte Michael Biermeier und ich alle neun Dekanate unseres Bistums besucht. Ziel war, alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden weiter zu sensibilisieren gegenüber jedweder Form sexualisierter Gewalt. Die Haltungsarbeit im Bistum Würzburg haben wir unter das Motto „Gemeinsam für eine sichere Kirche“ gestellt.
Ziel all unserer Anstrengungen ist es, im Bistum Würzburg eine Haltung zu implementieren, die hilft, in unseren Gemeinden und weiteren Kirchorten, wie beispielsweise Bildungshäusern oder Schulen sowie Verbänden und Gemeinschaften, für die Thematik des Missbrauchs zu sensibilisieren und dadurch schon jede
Grenzverletzung zu verhindern. Denn „wirksame Prävention ist ein Marathon und kein Sprint“, wie Professor Dr. Marcel Romanos bei der Vorstellung des UKAM-Gutachtens so treffend sagte.
Wie groß die Aufmerksamkeit für das Thema ist, zeigt schon die Zahl von 1400 Haupt- und Ehrenamtlichen, die wir mit den neun Dekanatsbesuchen erreicht haben. Wir haben viele positive Rückmeldungen erfahren, es wurden aber auch die Grenzen des bisher Erreichten sichtbar.
Wir müssen daher auch in Zukunft die zentrale Bedeutung unserer Präventionsmaßnahmen herausstellen. Insbesondere gilt es, Haupt- und Ehrenamtliche weiter zu motivieren, um damit die Akzeptanz zu erhöhen.
Es geht um nichts weniger als einen umfassenden Kulturwandel im Umgang mit dem Thema von sexualisierter Gewalt: Weg von jeder Tabuisierung, hin zu einer hohen Achtsamkeit.
Dies lässt sich nur mit einer Anstrengung aller verwirklichen.
Die Empfehlungen der UKAM helfen uns, unsere Arbeit konsequent weiter zu entwickeln: Dies betrifft sowohl die personelle Ausstattung als auch strukturelle Anpassungen im Bereich von Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Im Mittelpunkt steht jedoch das Ziel, alle zu gewinnen für unsere Haltung: „Gemeinsam für eine sichere Kirche!“
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Teil 5 – Bischof Dr. Franz Jung – Ausblick auf die nächsten Schritte der Aufarbeitung
Abschließend stelle ich Ihnen unsere Timeline für die nächsten Monate vor. In enger Abstimmung mit dem Diözesanrat unter Vorsitz von Dr. Michael Wolf und unserer Mitarbeitendenvertretung unter Vorsitz von Dorothea Weitz werden wir die Aufgaben angehen, die uns mit dem Gutachten gestellt sind:
Am 14. Mai 2025 habe ich den Betroffenenbeirat und weitere Betroffene sexualisierter Gewalt im Bistum Würzburg zu einem Austausch über das Gutachten der UKAM eingeladen. Es ist mir wichtig, dass dieses Gespräch den Ausgangspunkt für die nächste Phase bildet.
Am 16. Mai 2025 werden wir mit der UKAM einen gemeinsamen Workshop abhalten. Dies ist der erste Schritt der Begleitung durch die UKAM bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen.
Anschließend werden wir bis zum Ende des 3. Quartals 2025 konkrete Maßnahmen aus den Empfehlungen der UKAM ableiten.
Im April 2026 werden wir dann – ein Jahr nach Veröffentlichung des Gutachtens – ein Update geben über die Fortschritte unserer Arbeit.
Erneut danke ich dem Betroffenenbeirat, der UKAM, Herrn Professor Dr. Schneider und seinem Team sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bischöflichen Ordinariat für ihre Unterstützung bei unseren Bemühungen um Aufarbeitung.
Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen nun für Fragen zur Verfügung.“
(1625/0385; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet