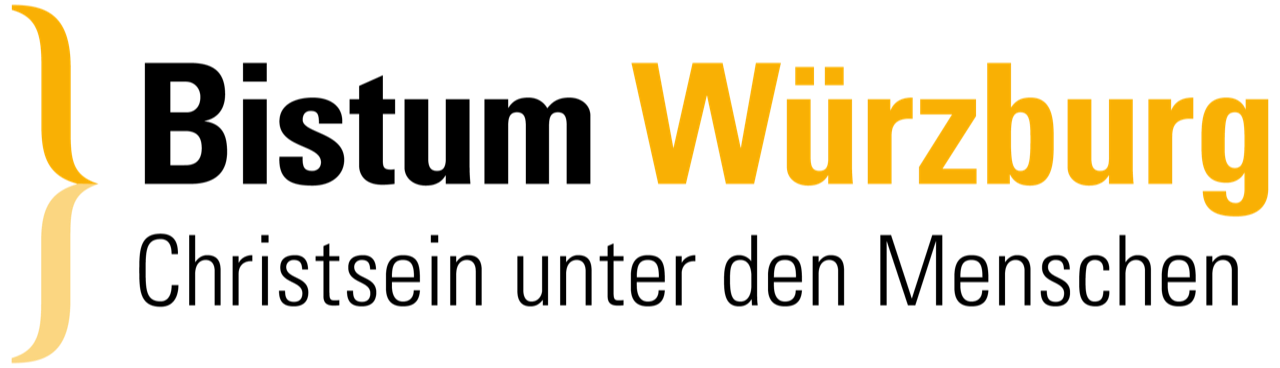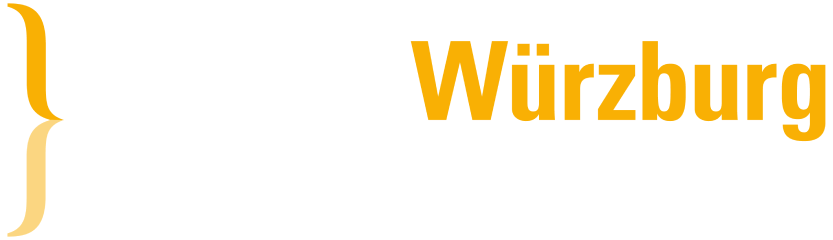Liebe Schwestern und Brüder,
diesen drei heiligen Tagen eignet eine eigentümliche Dichte. Obwohl sie zeitlich so begrenzt sind, umfassen diese Tage die ganze Menschheitsgeschichte. Denn die Frucht dieser Tage umschließt das innerste Wesen des Menschseins: Leben, Freiheit und Liebe.
Alle Fragen nach dem Woher und Wohin, nach dem Warum und Wozu lassen sich in diesem Liebesgeschehen Jesu Christi ausdeuten und beglückend wahrnehmen. So sehr auch das Gewalthafte, Blutige und Ungerechte in diesen drei letzten irdischen Lebenstagen Jesu vordergründig dominiert, im Inneren erschließt sich die uns nacheilende Liebe des unsichtbaren Gottes und öffnet uns eine ganz neue Dimension des Menschseins: das ewige Leben in unvorstellbarem Glück.
In dieser Sterbestunde unseres Herrn möchte ich von einer Afrikanerin sprechen, deren Leben so grausam und brutal verlief, dass man vordergründig verzweifeln möchte.
Ich spreche von Josefine Bakhita, einer Frau aus dem Sudan. Sie wurde 1869 in der Provinz Darfur im Sudan geboren und mit etwa neun Jahren von arabischen Sklavenhändlern geraubt und auf dem Sklavenmarkt in Khartum verkauft. Die Traumatisierung dieses Mädchens ging so weit, dass sie ihr Gedächtnis verlor und sich selbst an ihren Vornamen nicht mehr erinnern konnte. Daher wurde sie Bakhita – die, die Glück hat – genannt. Fünf Sklavenhändlern war sie ausgeliefert. Einer ließ sie am ganzen Körper (außer dem Gesicht) tätowieren. 144 Narben behielt sie zurück.
Mit 14 Jahren kam sie in Istanbul zu dem italienischen Vizekonsul Callisto Legnani. Er war wohl der erste Mensch, der gut zu ihr war. Als er nach Genua zurückkehrte, bat sie ihn, sie mit nach Italien zu nehmen. Dort gab sie der Vizekonsul einer befreundeten Familie als „Geschenk“, damit sie deren Säugling betreute.
Obwohl sie großzügig behandelt wurde, betrachteten diese Leute sie doch als Sklavin. Da diese Familie geschäftlich außer Landes gehen musste, übergaben sie Bakhita und das Baby dem Kloster der Canossianerinnen in Venedig. Dort lernte sie den Glauben an Jesus Christus kennen und lieben. Sie wurde 1890 auf den Namen Josefine getauft, wurde gefirmt und empfing die heilige Kommunion. Doch als die Familie Michieli nach Hause zurückgekommen war, verlangten sie die „Rückkehr“ Josefines und zogen vor Gericht, um ihr „Eigentum“ wiederzubekommen. Der Richter entschied zugunsten des Mädchens, das als Pförtnerin in den nächsten 50 Jahren in einem Anwesen, das Schule, Kindergarten, Waisenhaus und Erholungsheim umfasste, in der norditalienischen Provinz Vicenza wirkte. Ihr – trotz allem schrecklich Erlittenen – fröhliches Wesen eroberte die Herzen der Menschen, die sie „la nostra madre moretta“ – „unsere kaffeebraune Mutter“ – nannten.
Josefine starb am 8. Februar 1947 und wurde am 1. Oktober 2000 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.
Anderthalb Jahre nach ihrem Tod, am 10. Dezember 1948, veröffentlichten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Staatengemeinschaft hatte sich vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und der Shoah dazu durchgerungen, ein für alle Mal klarzustellen: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ Die historischen Wurzeln der Magna Charta, das lässt sich schon im ersten Artikel ersehen, sind die christlich tradierten Begriffe wie Würde und Gewissen. Freiheit und Vernunft sind nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ebenso jedem Menschen zuzusprechen wie Leib- und Lebensrecht, Freiheits- und Gleichheitsrecht, politische, soziale und kulturelle Rechte.
Christus ist für alle Menschen gestorben, damit alle ein menschenwürdiges Leben haben sollten. Leider sieht es auch heute noch in weiten Teilen der Welt – und selbst bei uns – schlimm aus. Weiterhin versklaven Menschen Menschen, rauben ihnen ihre Würde und Freiheit. Wir brauchen nur an die aktuellen Probleme der Zwangsprostitution zu denken. Es ist ein Skandal, was sich auch mitten in unserem Land abspielt!
Bakhita hatte Glück, Christen zu begegnen, die sie auf Christus aufmerksam machten. Bei ihm fand sie ihr inneres Gleichgewicht und die eigentliche Freiheit.
Sind wir uns eigentlich unseres Glückes bewusst, diese Erkenntnis zu haben, Christen sein zu dürfen und aus diesem Glauben heraus allen Menschen zu Freiheit und Würde verhelfen zu können?
Bischof Franz Kamphaus schrieb: „Das Kreuz offenbart nicht nur den Abgrund menschlicher Gewalttätigkeit, sondern auch den Abgrund göttlicher Gewaltlosigkeit. ‚Ecce homo’: Seht den geschundenen Menschen – und den lebendigen Gott auf seiner Seite! ‚Ecce homo’: Seht Jesus! Er ist einer von uns und doch ganz anders als wir. Jesus widersteht der Gewalttätigkeit nicht durch einen Akt der Gegengewalt, nicht durch eine Aktion seiner Allmacht, sondern durch die Passion seiner ohnmächtigen, machtvollen Liebe. Er zahlt nicht heim. Er steigt aus dem Gewaltspiel aus, er unterbricht es und wird dabei selbst zum Opfer. Das Kreuz ist das Zeichen unzerstörbarer Liebe.“
Christus ist für uns gestorben, damit wir seine Botschaft verbreiten und leben. Setzen wir sie um!
Amen.