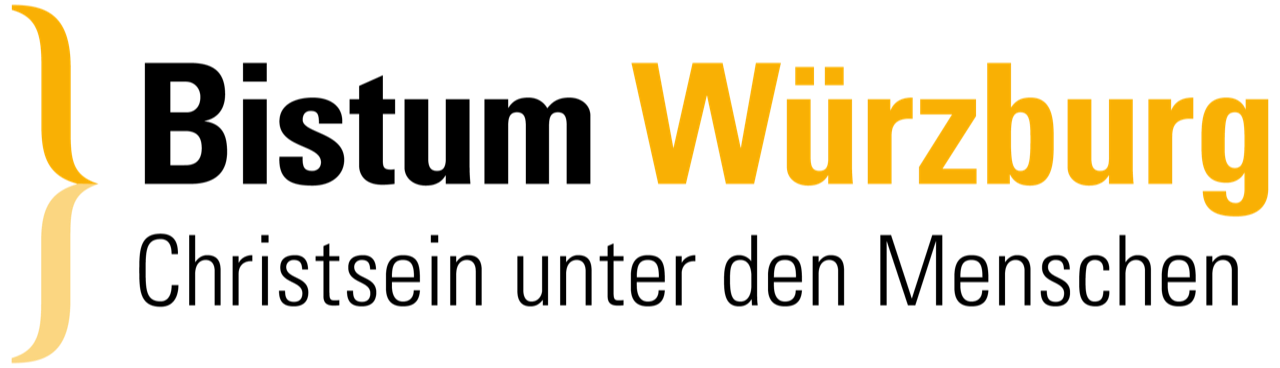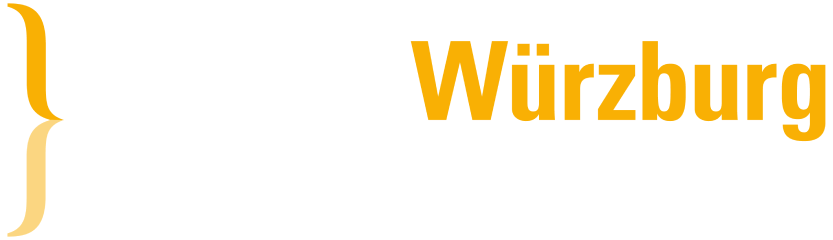Liebe Schwestern und Brüder,
diese heilige Osternacht ist die Mutter aller Vigilien, der Nachtwachen, das heißt, sie birgt in sich den ganzen Glaubensreichtum, der durch Jahrtausende aus Lebenserfahrung und Heilszusage erwachsen ist und auf das unfassbare Osterereignis ausgerichtet ist.
Die Grundaussage, auf die alle Texte und Lieder hinzielen, lautet: Christus ist von den Toten erstanden.
Es scheint so zu sein, dass viele unserer Mitmenschen nicht – oder nicht mehr – an diese alle bisherige menschliche Erfahrung umstoßende Botschaft glauben.
Wir haben eben in der Lichtfeier durch das Entzünden der Osterkerze die Auferstehung Christi verkündet und in der Lichtfeier entfaltet. Wir haben im ausgiebigen Wortgottesdienst in den Lesungen des Alten Testamentes die Spuren göttlichen Zugehens auf uns Menschen aufgerufen und in den neutestamentlichen Texten die ersten Zeugen der Auferstehung zu Wort kommen lassen.
Es ist wahr, das Faktum der Auferstehung ist nicht wissenschaftlich beweisbar. Es entzieht sich einerseits menschlich beckmesserischem Zugriff und andererseits bleibt bei vielen wegen des unösterlichen Elends in der Welt ein bohrender Zweifel.
Wer wollte es auch den Menschen verdenken, dass sie angesichts der zunehmenden Trockenzonen der Wüsten und der Zerstörung unserer Umwelt zweifeln, angesichts des weltweit wachsenden Elends, der immer wieder neu aufbrandenden Kriegszonen und der ungelösten Probleme an kein neues, besseres Leben nach der Auferstehung Jesu glauben?
Das Problem ist nicht die Verkündigung der Auferstehung, deren Faktum gegenüber die ersten Zeuginnen und Zeugen ebenfalls sehr skeptisch waren. Das Problem ist die für uns sichtbar ausbleibende Konsequenz der Auferstehung. Alles, was schon vor der Auferstehung Jesu an Schrecklichem, Dramatischem und Unerklärbarem geschehen ist, vollzieht sich auch nachher: Menschen leiden, Ungerechtigkeiten triumphieren, der Tod hält weiter bei uns sichtbare Ernte.
Was hat sich dann durch die Auferstehung Jesu geändert? Es waren zunächst und zuerst einmal die Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind! Sie waren über dieses eigentlich unfassbare Ereignis so betroffen, dass sie ihr Leben völlig verändert haben.
Schauen wir auf die Frauen, die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Sie kommen nicht zum Glauben an die Auferstehung Jesu durch das leere Grab. Sie glauben erst, nachdem sie ihm wahrhaft begegnet sind. Daraufhin können sie von dem Erlebten her nicht schweigen und verändern ihr ganzes Leben.
Dann die Apostel. Sie zweifeln zunächst die Kunde von der Auferstehung an. Erst als sie dem Auferstandenen selbst begegnen – hinter verschlossenen Türen – kommen sie zum Glauben, geben ihr bisheriges Leben auf, verlassen Familie und Heimat und ziehen in die Welt hinaus, um diese frohe Botschaft zu verkünden.
Paulus, der als Saulus zunächst heftig die Christen wegen dieser Botschaft verfolgt hatte, findet erst zum Glauben an den Auferstandenen, nachdem er ihm vor Damaskus begegnet ist. Daraufhin verändert er sein ganzes Leben, achtet nicht Spott, Verfolgung, Kerker und Tod.
Alle diese Zeuginnen und Zeugen des Auferstandenen verändern sich also selbst aufgrund der neuen Perspektive. Der Tod verliert seinen archaischen Schrecken, das Leid seine tödliche Kraft, der Schmerz seine lähmende Angst. Es ist wahr: Das Leben nach der Auferstehung Jesu hat sich offensichtlich im erfassbaren Ablauf der Welt nicht verändert. Aber Entscheidendes ist doch geschehen: Das Faktum der Verlorenheit ist zugunsten des in Gott Aufgehobenseins in Leben verwandelt. Wir dürfen wieder Zutrauen, Hoffnung und innere Stabilität erwarten.
Diese die Welt im Anschluss an die Auferstehung Jesu grundsätzlich verändernde Botschaft von der Auferstehung der Toten insgesamt wird bei uns erst ankommen, wenn wir dem Auferstandenen selbst begegnen.
Wie? Wenn wir ihm in seinem Leben spendenden Wort begegnen; wenn wir ihn in den Sakramenten berühren; wenn wir ihn in der heiligen Kommunion in uns aufnehmen; wenn wir ihm im notleidenden Nächsten begegnen und in unseren Gebeten mit ihm Kontakt pflegen.
Der im vergangenen Jahr verstorbene langjährige Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher hatte in einer Ostermeditation geschrieben: „Wir sollten, wenn wir uns zum Glauben an diesen Christus durchringen, in uns ein österliches Schauen, Hören und Fühlen der Weltwirklichkeit entfalten. Das ereignet sich, wenn man zum Beispiel spürt, dass sich bei einem Menschen Vorurteile auflösen, Barrikaden auf den Straßen des Herzens abgeblockt werden, wenn ein gewisses Vertrauen aufblüht.“ (Stecher, Reinhold: Ein Singen geht über die Erde, 1994)
Sicherlich sollten wir die vielen Präludien vor der großen Auferstehung am Ende der Tage (R. Stecher) in den durch die Auferstehungsbotschaft veränderten Menschen wahrnehmen – und auch in uns.
Da, wo wir unser Denken und Verhalten im Blick auf den Auferstandenen und in ihm auf das kommende ewige Leben positiv verändern, macht sich schon jetzt Auferstehung bemerkbar. Es nützt uns nichts, das Elend der Welt zu konstatieren und zu beweinen, es hilft vielmehr, es wegzulieben. Diese wirkmächtige Kraft, die wir in Texten, Liedern und Kunstwerken und erst recht in den Heiligen im Laufe der Kirchengeschichte vorfinden, legt ebenfalls Zeugnis von der neuen Wirklichkeit ab.
Zum Schluss soll noch einmal Bischof Stecher zu Wort kommen: „Die Chance hat eindeutig das Leben, nicht der Tod. Und darum geht ein Singen über die Erde, trotz allem.“ (Ebd.)
Amen.