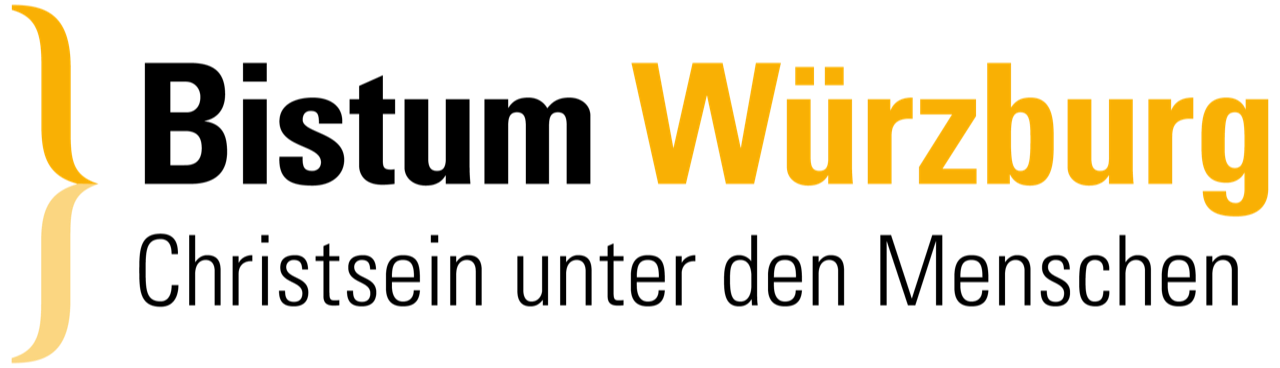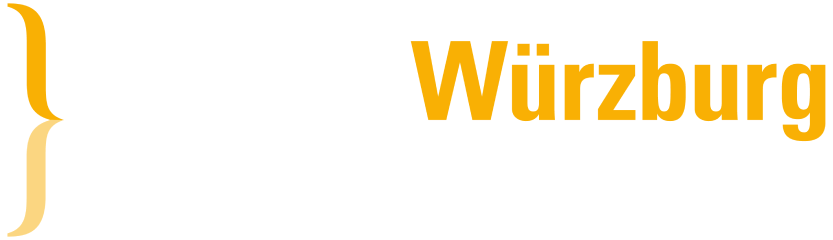Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Schwestern und Brüder,
wir feiern heute Morgen während der Kiliani-Wallfahrtswoche miteinander die Festmesse hier im Sankt-Kilians-Dom. Im Blick auf unsere Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan gedenken wir dankbar Ihres missionarischen Eifers, der sie im 7. Jahrhundert aus Irland in unser Frankenland geführt hat. Sie haben voller Elan und unter Einsatz ihres Lebens den Glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus verkündet. Schließlich haben sie gar das Martyrium erlitten.
Mir ist aus den vorhandenen Unterlagen nicht deutlich geworden, inwieweit sie musikalisch tätig waren. Sicherlich spielte aber auch schon damals innerhalb der Gottesdienste die Musik eine große Rolle.
Für unsere heutige Zeit ist die Musik nicht mehr aus unseren Gottesdiensten wegzudenken.
Warum ist sie für uns so wichtig?
Die Musik, die wir im Gottesdienst und auch heute in diesem Pontifikalamt für Chöre und Blasmusiker hören, hat einen hohen Stellenwert in der Kirche. Sie ist von Anfang an nicht nur als schmückendes Dekor, als Beiwerk, als eine Überhöhung der Feier gesehen worden, sondern als ein Bestandteil der Liturgie. So heißt es im Konzil: „Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Musik ausmacht.“ (Kleines Konzilskompendium. VI., 112. S. 84).
Rainer Maria Rilke hat in einem Vers seines Gedichtes „An die Musik“ das Wesen der Musik aufleuchten lassen: „Musik – Du Sprache wo Sprachen enden“. Gerade die Musik, die nach Heinrich Heine „zwischen Materie und Geist, zwischen Zeit und Ewigkeit steht“, vermag den Menschen in seinem Innersten zu berühren und über sich selbst hinaus zu erheben. Zugleich aber hat die Musik im Gottesdienst die Möglichkeit, den Bogen zwischen der unsichtbaren himmlischen und der sichtbaren und hörbaren irdischen Musik zu schlagen. Wenn in der Heiligen Schrift von der himmlischen Liturgie die Rede ist, dann doch vornehmlich im Zusammenhang mit der Musik.
Die Musik ist so etwas wie eine geistige Jakobsleiter. Sie verbindet die sichtbare, empirisch erfahrbare, geschöpfliche Wirklichkeit mit der uns im Glauben verkündeten und erschlossenen Realität Gottes. Sie ist damit auch eine Jakobsleiter zwischen Vernunft und Glaube, zwischen materieller und geistiger Wirklichkeit.
Musik erklingt und erreicht unser Herz. Sie verfliegt wieder und ist nur im Augenblick des Aufnehmens erfahrbar. Aber sie klingt nach und sie erschließt Räume, von denen wir auf einmal spüren, dass hier mehr zu finden ist als menschliches Können, Kompositions- und Interpretationsgabe. Wie jegliche Kunst den sichtbaren, empirisch und denkerisch erfahrbaren Grund übersteigt, so erst recht auch die Musik. Sie führt wie eine Brücke in eine ungeschaffene Wirklichkeit.
In Gott fallen die beiden Wirklichkeiten von Diesseits und Jenseits, Wissen und Glauben zusammen. Der Mensch, der sich auf diese Schöpfung einlässt, gewinnt auch die Möglichkeit, den Schöpfer durch das Geschaffene zu erfassen. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, prallen Glauben und Wissen nicht als zwei Wirklichkeiten aufeinander oder stehen beziehungslos nebeneinander, sondern erwachsen aus dem einen selben Urgrund: aus Gott.
Davon gibt die Musik auf unmittelbare Weise Zeugnis. Sie erweckt Emotionen, spricht Verstand und Herz an und führt so über jedes rationale Erkennen hinaus in den Raum Gottes, führt vom Diesseits in das Jenseits.
Als die Orgel als das königliche Musikinstrument unter Kaiser Karl dem Großen in unsere Liturgie eingeführt wurde, fand in der Kirche ein Instrument Platz, das seine Vorrangstellung bis heute beibehalten konnte. Die Vielfalt und Fülle der damit verbundenen Ausdrucksformen dürfen wir ja auch heute wieder erleben.
Großartige Kompositionen vieler Jahrhunderte lassen auch heute die Herzen der Gottesdienstbesucher höher schlagen. Wie sehr ist unsere Liturgie durch grandiose Musik bereichert worden. Zahlreiche Messkompositionen lassen uns den Atem der Ewigkeit spüren.
Heute Morgen dürfen wir über Ihre aktive Teilnahme in Chören und der Blasmusik wieder das Besondere dieser Musik erleben. Wir werden also mitten in einen Prozess hineingenommen, der nicht nur in der Zeit steht, sondern die Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinein öffnet.
In den letzten hundert Jahren wurde der Dialog zwischen der Kirche und der zeitgenössischen Musik – ebenso wie in der bildenden Kunst – nur mühsam geführt.
Mit dem Zweiten Vatikanum vollzieht sich der Wandel:
Jetzt rückt der Mensch mehr in den Blick. Es gilt nach dem Willen der Konzilsväter, ihn in seiner Lebenswirklichkeit wahrzunehmen. Der Theologie kommt dabei die Aufgabe zu, den Menschen mit seinen Fragen im Blick auf sein Heil abzuholen und in den Raum Gottes hineinzuführen. Kunst – und damit auch Musik – soll im Kirchenraum nicht museal behandelt werden. Sie soll vielmehr in ihrer Eigenwirksamkeit erkannt und gefördert werden. Das Konzil betont: „Der Schatz der Kirchenmusik möge mit größter Sorgfalt bewahrt und gepflegt werden…“ Dabei legt sich das Konzil nicht auf bestimmte Stilrichtungen fest, sondern betont: „Dabei billigt die Kirche alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und lässt sie zur Liturgie zu.“
Wir brauchen eine qualifizierte musikalische Gestaltung unserer Gottesdienste.
So möchte ich auch uns heute Morgen zurufen, alles daran zu setzen, Gott in würdigen Gottesdiensten zu loben.
Gott hat uns Augen, Ohren, Mund und Hände verliehen, ihn in seiner wunderbaren Schöpfung wahrzunehmen. Er hat uns kreative Fähigkeiten und die Liebe zur Musik geschenkt. Warum sollten wir nicht die Zinsen für diese Talente zurückzahlen, indem wir die uns geschenkten Gaben ausbauen und für ihn – auch in den Gottesdiensten – einsetzen?
Den letzten Satz der Psalmen habe ich als ersten Satz in das neue Gebet- und Gesangbuch Gotteslob gestellt. Er lautet: „Alles, was atmet, lobe den Herrn!“ (Ps.150,6) Die ganze Schöpfung soll dem Lobe Gottes dienen. Der Mensch, als die Krone der Schöpfung, soll dieses unterschiedliche Lob in die Sprache des Herzens übertragen. Wir sagen mit Recht: Ein gesungenes Gebet ist ein doppeltes Gebet.
Von Herzen danke ich Ihnen für Ihren großen Einsatz in der Kirchenmusik und hoffe, dass auch in unserer Zeit weiterhin viele Menschen den Kontakt mit der Kirchenmusik pflegen - zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen.
Amen.